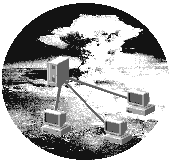|
Die Geburtsstunde des Internet war in den 60er Jahren, auf dem Höhepunkt des kalten Krieges. Der Sputnik-Schock der 50er Jahre saß tief bei den Amerikanern, und das Verteidigungsministerium, das Department of Defence (DoD), spendierte großzügig Milliarden, damit die Amerikaner beim Wettrennen im All die Nase vorn haben wür-den. Das Geld wurde von einer Abteilung des DoD verwaltet, die sich Advanced Research Projects Administration, kurz ARPA nannte. Als jedoch die NASA als selbständige Weltraumbehörde gegründet wurde, hatte die ARPA ihre Existenzberechtigung scheinbar verloren. Man verlegte sich auf Grundlagenforschung im Bereich Computerkommunikation. Um die Ausgaben vor dem Congress zu recht-fertigen, gab man sich den sogenannten „EMP Effekt" an.
EMP oder „Electro-Magnetic Pulse" ist eine statische Entladung von ungeheurer Kraft, die – neben Druckwelle, Hitze und radioaktiver Strahlung – bei der Zündung einer Atombombe entsteht. EMP, so hatten Forscher herausgefunden, sei in der Lage, ganze Telefonnetze zusammenbrechen zu lassen. Für die Militärs zeichnete sich ein Horror-Szenario ab: Die Russen müßten nur ein paar Bomben in der Atmosphäre über den amerikanischen Kommandozentralen explodieren lassen, um die Kommunikations-Infrastruktur der US-Streitkräfte lahmzulegen.
Das ARPAnet, wie es getauft wurde, hatte also eigentlich einen rein militärischen Zweck: Es sollte der Prototyp eines atomsicheren Datennetzwerks zwischen verschiede-nen Superrechnern im Lande sein. Dabei ging man von einem – zumindest für Militärs – recht ungewöhnlichen Modell aus. Kommunikation sollte direkt zwischen einem Absender und einem Empfänger stattfinden; vom dazwischenliegenden Netz wurde angenommen, daß es unzuverlässig, notfalls löchrig, womöglich sogar teilweise zerstört sei.
Das Ganze kann man sich wie ein gewaltiges, weltumspannendes Spinnennetz vorstellen. Selbst wenn Sie mit einem Stock oder Finger ein Loch in die seidigen Maschen reißen, funktioniert es noch. Die Fliege kann sich weiterhin darin verfangen, und die Spinne kann, wenngleich auf Umwegen, zu ihr gelangen, um sie zu verspeisen. Wenn es ihre Zeit erlaubt, repariert die Spinne ihr Netz auch, aber das ist zunächst nicht das Vordringlichste.
Um das telekommunikative Gegenstück zum Spinnennetz zu erreichen, ging das ARPAnet einen völlig neuen, revolutionären Weg. Das Internet Protocol (IP) kommt mit einem Minimum an Informationen über die an dem Vorgang beteiligten Rechner aus. Statt Computer fest miteinander zu verbinden und Dateien am Stück zu übertragen, benützt IP das Prinzip der sogenannten Paketvermittlung. Eine Datei wird in viele kleine Datenpakete aufgeteilt, die durchnummeriert und jeweils mit der Empfängeradresse versehen werden. Dann schickt der Computer sie auf die große Datenreise. Jedes Paket sucht sich dabei seinen eigenen Weg, nämlich dort, wo im Netz gerade Leitungskapazität frei ist. Ein Teil einer Nachricht geht also vielleicht über das Transatlantikkabel, während der nächste Teil über Tokio geleitet wird. Dem Empfänger ist das egal: Sein Computer wartet einfach, bis alle Pakete da sind, setzt sie dann in der richtigen Reihenfolge wieder zusammen und zeigt sie auf dem Bildschirm an.
Das Internet Protocol ist also das eigentlich Geniale am Internet. So einfach und überzeugend, daß es sich sofort überall durchzusetzen begann, obwohl die Frage eines weltweiten Computernetzwerks doch eigentlich Sache von Weltorganisationen wie die ISO (Organization for International Standardization) hätte sein müssen. Doch während die ISO jahrelang ihre Tagungen abhielt (sie tagt im Grunde heute noch, natürlich ohne konkretes Ergebnis), wurden die Leute an den Unis langsam ungeduldig. IP gab es, es funktionierte, also wozu lange warten? Mit dieser hemdsärmeligen Einstellung machten sie IP in den letzten Jahren zum de facto Weltstandard für PC-Kommunikation.
Auf der Grundlage von IP entwickelten sich zunächst in den USA parallel zum ARPAnet eine ganze Reihe weiterer Netzwerke, zum Beispiel das Wissenschaftsnetz CSNnet, das zahlreiche Universitäten in den USA miteinander verband, oder das BITnet („Because It's Time Net").
Im Jahre 1979 beschlossen zwei Studenten an der Duke University, ihre UNIX-Rechner per IP-Netzwerk zu verbinden, um besser miteinander kommunizieren zu können. Das Ganze nannten sie Usenet, oder „User's Network". Das System funktioniert bis heute, nur daß statt zwei Computer das gesamte Internet als Übertragungsnetz verwendet wird. Dennoch ist das Usenet strenggenommen gar kein Bestandteil des Internet, sondern ein separates Netzwerk, das sich lediglich der Infrastruktur des Internet bedient.
Während andere PC-Netze, ja selbst das Internet, im Grunde von oben nach unten gewachsen sind, ist das Usenet ein echtes basisdemokratisches Gebilde, das von unten nach oben wuchs. Das erklärt vielleicht auch, weshalb es im Usenet noch lockerer zugeht als im übrigen Internet. Es ist die Domäne der sogenannten Newsgroups: Diskussions-foren über alles von Internet-Kultur bis Kuchenbacken, von Kierkegaard bis Kinderporno.
Es gibt nichts, was es nicht gibt im Usenet, aber es gibt auch strenge Benimmregeln. Man kann das ganze heiß-diskutierte Thema „Netiquette" mit einem einzigen Satz zusammenfassen: Leben und leben lassen. Wer nieman-den stört, den läßt man auch in Ruhe. Wer einen Diskussi-onskreis jedoch mit ir-re-le-vanten Sprüchen oder gar mit plumper Werbung belästigt („Bandbreite klauen" heißt das in der Insidersprache des Net), wird gnadenlos mit „Flames" – bitterböse, oft sehr persönliche Beleidi-gungen – gestraft. Im Wiederholungsfall droht sogar das „trashen": Der Delinquent wird megabyte-weise zugemüllt mit irgendwelchen Computerdateien, die seinen Rechner blockieren und ihn eine ganze Zeitlang daran hindern, am Internet-Leben teilzunehmen.
Anfang der 80er Jahre steckten die oben bschriebenen Netzweerke alle noch in den Kinderschuhen. Gleichzeitig begann im PC-Bereich eine Entwicklung, die von entscheidender Bedeutung sein sollte: Die LAN-Technik (Local Area Network) setzte sich durch. Plötzlich war es für wenig Geld möglich, mehrere Arbeitsplatzrechner miteinander zu verbinden, um auf gemeinsame Datenbanken zurückzugreifen, Programme gemeinsam zu nutzen und sich gegenseitig elektronische Post („E-Mails") zukommen zu lassen. Viele dieser privaten, meist firmeninternen Netzwerke basierten und basieren heute noch auf dem Internet Protocol oder unterstützen IP wenigstens. Was fehlte, war eine Möglichkeit, diese vielen kleinen örtlichen Netze miteinander zu verbinden.
Im Jahre 1986 wurde in Amerika mit dem Aufbau eines Hochleistungs-Netzwerks begonnen, das die Rechenzentren von fünf Universitäten verband, an denen sogenannte Supercomputer installiert waren. Das amerikanische NSF-net (National Science Foundation Network) sollte Akademikern, die sich nicht gerade an den betreffenden Hochschulen befanden, den Zugang zu den sündhaft teuren Superrechnern ermöglichen. Es genügte deshalb nicht, nur die fünf Unis zu verbinden. Also wurden Verbindungen zu bereits existierenden regionalen Netzwerken geschaffen, was natürlich die Zahl derjenigen, die das Netz benützten, sprunghaft steigen ließ.
Obwohl die Mittel für das NSFnet von der Regierung kamen, wurde den Unis der finanzielle Aufwand mit der Zeit zu groß, und schauten sich nach weiteren Partnern um. 1987 erhielt ein Konsortium, bestehend aus den Firmen IBM, MCI und Merit Network, den Auftrag, das NSFnet zu betreiben. Um der wachsenden Nachfrage Herr zu werden, wurde die bestehende Leitungskapazität stets ausgebaut, bis das NSFnet alle anderen Netzwerke bei weitem übertraf. Die alten Netze - ARPAnet und CSNnet - gingen daher mit der Zeit ganz im NSFnet auf. Das AR-PAnet etwa stellte erst 1990 den Dienst ein – 21 Jahre nach seiner Gründung.
Das NSFnet mit seinen dicken Strippen – sogenannte T3-Glasfaser-Leitungen mit einer Übertragungsleistung von sage und schreibe 45 Millionen Bit pro Sekunde – bildete fortan das „Backbone", das Rückgrat des Internet in den USA. Fast alle privaten Internet-Anbieter, die zum Teil eigene Leitungen besitzen, benützten das NSFnet als sogenanntes „Fallback" – als Notnagel, quasi, über den man den überschüssigen Datenverkehr leiten konnte, wenn die eigenen Leitungen überlastet waren. Im Grunde wären sie mit dieser Lösung auch auf Dauer zufrieden gewesen – wenn es nicht diese lästige Behörde, den amerikanischen Rechnungshof gegeben hätte. Die Finanzwächter waren nämlich der Ansicht, daß es nicht gerecht sei, wenn der US-Steuerzahler einen wesentlichen Teil des internationalen Datenverkehrs finanziere.
Es kam also, wie es kommen mußte: Anfang Mai 1995 wurde das gute, alte NSFnet abgeschaltet. Und die weltweite Internetgemeinde hielt ein paar Tage än-gstlich die Luft an: Würde das Internet nun zusammenbrechen? Oder ist das Net inzwischen so stabil, daß es diese Bela-stungsprobe überlebt?
 Natürlich hat es überlebt, sehr gut sogar. Es arbeitete einige Tage etwas langsamer als sonst, aber auch nur in ganz bestimmten Bereichen. Denn das NSFnet wurde ja nicht wirklich abgeschaltet. Es steht nur nicht mehr jedermann kostenlos zur Verfügung, sondern bildet einen Teil des täglich weiter wachsenden Geflechts von Leitungen, über die sich das Internet seinen Weg von Computer zu Computer sucht. Natürlich hat es überlebt, sehr gut sogar. Es arbeitete einige Tage etwas langsamer als sonst, aber auch nur in ganz bestimmten Bereichen. Denn das NSFnet wurde ja nicht wirklich abgeschaltet. Es steht nur nicht mehr jedermann kostenlos zur Verfügung, sondern bildet einen Teil des täglich weiter wachsenden Geflechts von Leitungen, über die sich das Internet seinen Weg von Computer zu Computer sucht.
|